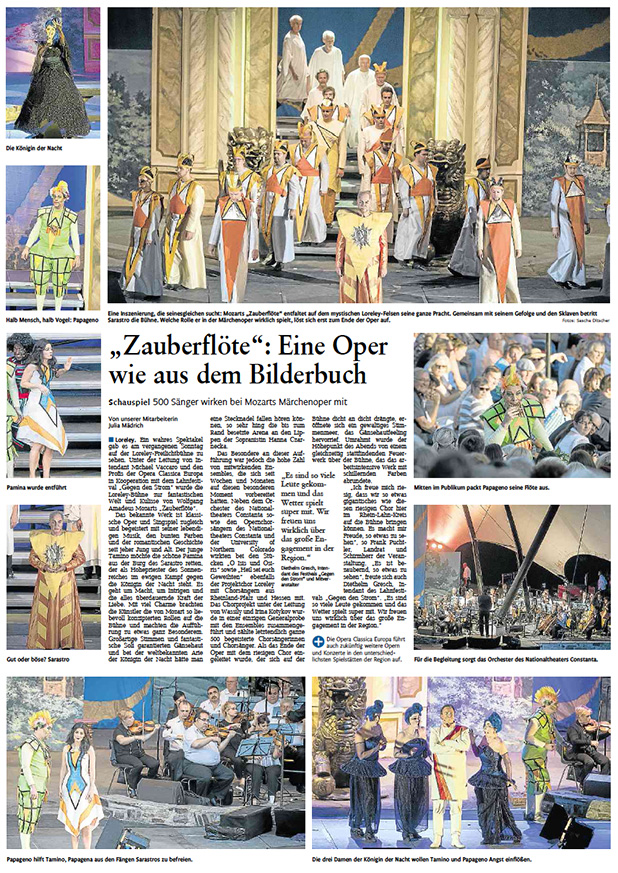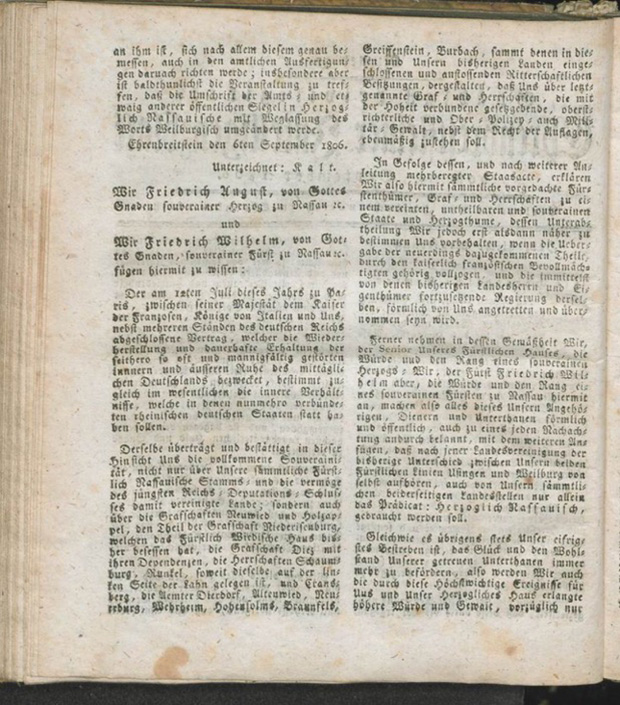Rhein-Lahn-Zeitung, 20. September 2016:
Vortrag Beim zweiten Nassauer Dialog spricht Ex-ZDF-Intendant Markus Schächter über die Branche
Von unserem Redakteur Carlo Rosenkranz
Nassau. Rund 140 Gäste sind der Einladung zum öffentlichen Vortrag des zweiten „Nassauer Dialogs“ in die Stadthalle gefolgt. Prof. Markus Schächter, ehemaliger Intendant des ZDF, legte seine drei Thesen zur Frage dar, wohin sich die Medien als sogenannte vierte Gewalt entwickeln. Interessierte Bürger aus Nassau und dem Umland, die knapp 30 geladenen jungen Führungskräfte, Medienschaffende sowie Vertreter der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft (FvSG) und der G. und I. Leifheit-Stiftung tauschten sich im Anschluss durchaus kontrovers noch lange über das Thema im persönlichen Gespräch aus.
Schon die Grußworte stießen direkt zum Thema vor. Die Grenzöffnung für Tausende Asyl suchende fand während der Premiere des Nassauer Dialogs vor einem Jahr statt, erinnerte Prof. Hans-Günter Henneke, Vizepräsident der FvSG. Nun werde offenbar, dass Medien und Politik in einer Vertrauens- und Legitimationskrise steckten. Für den politischen Bereich werde das an den hohen Stimmenanteilen der AfD bei mehreren Landtagswahlen sichtbar. Vielen Menschen sei der Glaube an den eigenen Fortschritt verloren gegangen. Es fehle das Gefühl von Sicherheit, wobei dieses Empfinden völlig losgelöst von der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage sei. „Wir stehen gut da“, meinte Henneke. An die Medien stellte er die Frage, ob es richtig gewesen sei, so breit über die Pegida-Demonstrationen im vergangenen Winter zu berichten und jeden Halbsatz aus der bayerischen CSU zu verbreiten. „Personalisieren wir, skandalisieren wir, oder sind wir lösungsorientiert?“, sagte Henneke.
Das von Pegida-Anhängern genutzte Bild des Jornalisten mit langer Pinocchionase führte Markus Schächter, der seit 2012 Honorarprofessor für das Fach Medienethik ist, zum Auftakt seines Vortrags an. Der mittlerweile verbreitet genutzte Begriff „Lügenpresse“ habe seinen Ursprung im Dritten Reich und sei ein „aggressives Synonym für einen eklatanten Vertrauensbruch mit den etablierten Medien“. Die Medien würden verdächtigt, Informationen zu unterschlagen und Teil des Systems zu sein. Diese Ansicht werde auch in weniger radikalen Lagern vertreten. Da das Vertrauen das höchste Gut der Medien sei, gehe es für sie ans Eingemachte.
Dass auf Journalisten geschimpft werde, sei nichts Neues. Das hätten Mainzer Mönche zu Gutenbergs Zeiten ebenso getan wie Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Joschka Fischer. Allerdings seien sie nie höher angesehen gewesen, als in den vergangenen 70 Jahren. Das Bundesverfassungsgericht habe ihnen eine Systemrelevanz in der deutschen Demokratie bescheinigt. „Der Begriff der vierten Gewalt ziert uns“, sagte Schächter. Die Medienvielfalt sei Grundlage für einen sinnvollen öffentlichen Diskurs. Obwohl Deutschland das beste Pressesystem der Welt habe, sei es an der Zeit sich selbstkritisch zu hinterfragen. Warum, erläuterte der gebürtige Pfälzer Schächter in seinen drei Thesen.
Das Internet hat Schächter zufolge nicht nur das Geschäftsmodell der „alten“ Medien ausgehöhlt, sondern auch deren Informationsmonopol zerstört. Das neue Medium verband er mit den Begriffen „selbstbewusst, militant, aggressiv“. Das Übermaß an Information verwirre viele Menschen. Zugleich meinten viele aufgrund der im Netz vorhandenen unzähligen, scheinbar objektiven Info-Angebote und Plattformen, sie wüssten es selbst am besten. Die Folge: Sie glauben den klassischen Medien nicht mehr. Das Netz aber sei ein „Spiegelkabinett der Spekulationen und Gerüchte“. Was früher am Stammtisch in kleiner Runde verhallte, finde nun einen unbeschränkten Echoraum.
„Absurder Wahnwitz“
Zugleich fürchte etwa ein Drittel der Bürger, ihr Zuwachs an Wohlstand ende, der Abstieg stehe unmittelbar bevor. „Während sie sich im täglichen Überlebenskampf wähnen, geht es objektiv vielen von ihnen besser als je zuvor“, sagte Schächter. Ihre Sorgen fänden sie weder in den Medien, noch in der Politik beachtet. Die Folgerung: Mainstreamjournalisten machen gemeinsame Sache mit der politischen Klasse. Die Vorstellung, die Kanzlerin telefoniere den Redaktionen jeden Morgen durch, was zu berichten sei, bezeichnete Schächter als „absurden Wahnwitz“. Im Gegenteil: „Es gibt eine unerhört große Meinungsfreiheit der Journalisten in unserem Land.“
Von zentraler Bedeutung ist für den Professor für Medienethik auch der Umgang der Journalisten mit den eigenen Fehlleistungen. Beim Zusammenbruch der US-Bank Leeman Brothers 2008 seien die Medien ihrer Funktion nicht nachgekommen. Im Zusammenhang mit der stark boulevardisierten Berichterstattung über den damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff habe die Presse die Ethik des eigenen Standes verletzt. Und das tagelange Schweigen über die Silvesternacht 2015 in Köln sei Futter für Verschwörungstheoretiker gewesen. Zuletzt habe besonders das Flüchtlingsthema an der Glaubwürdigkeit der Medien gekratzt. „Große Teile haben die Willkommenskultur übernommen. Kritische Stimmen waren gleich verdächtig“, sagte Schächter und folgerte für die Branche: „Wir waren zu einseitig.“
Nicht legitimiert
Auch kurzatmige Fehlmeldungen zum Absturz der German-Wings-Maschine in den Alpen und zum Amoklauf in München nannte der Referent als Beispiele, wie Journalisten unter dem – auch durch das Internet verstärkten – Druck, schnellstens Exklusives zu liefern, Fehler machten. „Es gibt in der Branche wenig Bereitschaft, sich zu entschuldigen.“ Als „vierte Gewalt“ sei man in gewisser Weise unbelangbar, weil man nicht über Wahlen legitimiert werden müsse.
Trotz aller aktuellen Probleme sieht Schächter die Zeitungen, Magazine und Sender auf einem guten Weg. „In den Redaktionen beginnt ein substanzielles Nachdenken“, meinte er. Die Debatte um Standards, Ethik und Qualitätsanspruch der Medien komme in Fahrt. Ohne ins Detail zu gehen, forderte er ein Regelwerk, das über die Leitlinien des Pressekodex hinaus geht. Wenn es stimme, dass Journalisten Maßstäbe nicht einhalten, die sie wie selbstverständlich an andere alegten, müsse man daran arbeiten. „Journalisten haben Moral zu haben, aber keine Moral zu verkündigen“, sagte Schächter. „Sie sind keine Prediger.“

Das ZDF-Orange kommt von den Nassauer Farben
Markus Schächter kam 1981 zum ZDF. Von 2002 bis 2012 war er Intendant. „In meiner Zeit beim ZDF wurde Marketing immer bedeutsamer“, sagte Schächter zu Beginn seines Vortrags in der Nassauer Stadthalle. Um die Jahrtausendwende habe man auf der Suche nach einer neuen Farbe für die Corporate Identity einen Workshop in der Nähe durchgeführt. „Das Orange haben wir aus Nassau“, sagte Schächter nun. Die auffällige Farbe verwandte keiner der Mitbewerber und sie hebt sich bis heute auf Bildern vom Mikrofondschungel heraus. crz